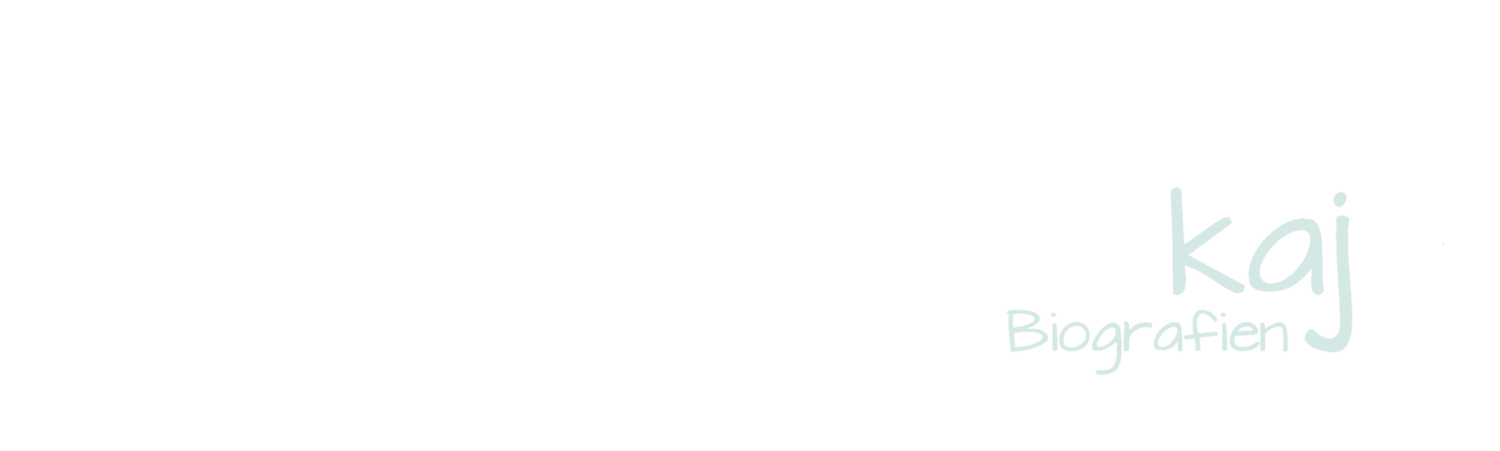Leseprobe: “Holz und Papier”
Lebenserinnerungen von Hans Jais, aufgezeichnet und herausgegeben von kaj-Biografien
Prolog
Ich habe meine Erinnerungen aufgeschrieben, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe nichts erfunden und nicht übertrieben, nach meinen Erinnerungen war es so. Je weiter sie zurückreichen, desto seltener kann ich sagen „Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen“. Im Laufe der 80 Jahre ist Vieles verblasst.
Wenn ich zum Beispiel an die ersten Schultage denke und meine Schwierigkeiten als Linkshänder, sehe ich ein Bild vor mir: Ich sitze heulend am Küchentisch bei den Hausaufgaben, meine Mutter daneben mit dem Kochlöffel in der Hand. Nehme ich den Stift in die linke Hand, haut sie mir auf die Finger. Warum? Ich weiß nichts über die Beweggründe meiner Mutter. Versuchte sie streng, aber mit liebevoller Fürsorge mir spätere Schwierigkeiten zu ersparen und aus mir einen Rechtshänder zu machen? War es gedankenloses Dreinschlagen, weil man halt rechts zu schreiben hatte? Und ging ich nach dieser schrecklichen Hausaufgabenstunde fröhlich zum Spielen raus? Oder war die Zeit geprägt von Furcht und Traurigkeit und der Angst vor dem nächsten Tag, an dem sich alles wiederholen würde? Ich weiß es nicht mehr. Es wäre ein Leichtes, mit Fantasie und malerischer Sprache eine schöne Geschichte aus solchen Erlebnissen zu machen. Wäre das authentisch, wären das noch meine Erinnerungen? Ich glaube eher nicht.
Kapitel ‘Von der Hand in den Mund’
Kempten 1935-1945
Hans Jais mit Familie, 1939
„Los Hansl, zieh die Sonntagskleider an“, rief meine Mutter und eilte ins Zimmer. „Der Nachbar hat einen Fotoapparat, er will uns fotografieren“. Ich konnte es kaum glauben, die guten Kleider, obwohl wir nicht in die Kirche gingen. Das hatte es vorher noch nie gegeben. Mutter, Vater, meine Schwester Irmgard und ich stellten uns hinter dem Haus auf die Wiese. Wir vier vor der Hecke, der Nachbar mit dem Fotoapparat uns gegenüber: Das ist meine früheste Erinnerung. Meine Schwester war damals drei Jahre alt, ich war vier und trug eine Samthose, die wie eine Trachtenlederhose geschnitten war. Sie war das einzige Stück Tracht, das ich je hatte. Weil mein Kopf damals so rund war, hieß es, „das ist der Max Schmeling“, der war zu dieser Zeit sehr populär. Meine Schwester war dagegen zart und spitz im Gesicht. „Du isst wohl deiner Schwester alles weg“, hörte ich immer wieder. Doch der Eindruck täuschte; wir passten beide sehr genau auf, dass keiner mehr bekommt und keiner weniger.
*
Als ich am 17. Januar 1935 als erstes von drei Kindern geboren wurde, ging es meinen Eltern so gut wie nie zuvor. Mein Vater war als Hilfsarbeiter in einer Fabrik angestellt und meine Mutter musste zum ersten Mal seit ihrer Schulzeit nicht arbeiten. Sie lebten in Schelldorf im Allgäu in einer kleinen Drei-Zimmer-Wohnung mit Wohnküche. Obwohl es kein fließendes Wasser gab und das Plumpsklo gewaltig stank, war das für meine Eltern Luxus und keinesfalls selbstverständlich.
Mein Vater Georg Jais wurde am 17. Februar 1892 als jüngstes von 14 Kindern in Olching geboren. Als er sieben Jahre alt war, starb seine Mutter und als er 20 war, sein Vater. Vom Tod der Mutter an lebte er abwechselnd bei den älteren seiner zwölf Schwestern. Alle waren bettelarm, keine wollte sich dauerhaft um den kleinen Bruder kümmern. „Jetzt nimmst du ihn mal“, hieß es, und mein Vater musste zur nächsten Schwester ziehen. Nach der Schulzeit verdingte er sich mehr als 20 Jahre lang als Knecht auf Bauernhöfen im Münchner Westen. Dann bekam er Probleme mit der Lunge. Der Arzt empfahl ihm, wegen des besseren Klimas ins Allgäu zu gehen. Er wurde Knecht in Waltenhofen.
Meine Mutter Theresia Jais, geborene Weiß, kam am 13. Juli 1906 in Thalhofen im Allgäu zur Welt. Es folgten drei Brüder, Hans, Benedikt und Ludwig. Der Vater war Handwerker und brachte die Familie gut über die Runden. Doch er fiel im Ersten Weltkrieg. Als meine Großmutter nach dem Krieg einen Schuster heiratete, begann das Elend. Der Schuster war von Anfang an alles andere als nett zu den Kindern, außerdem trank er. Nach und nach versoff er alles, was sie hatten. Er schickte meine Mutter schon mit zwölf Jahren als Dienstmagd in Stellung. Zuerst in eine Schreinerei, später in die Landwirtschaft und in einen Gasthof. Eines wiederholte sich bei jeder Stelle: Wurde sie krank, musste sie nach Hause. Das erzählte sie uns Kindern immer wieder. Niemand wollte eine Magd füttern, die nicht arbeitete. Und sei es für wenige Tage. Sobald sie sich einigermaßen erholt hatte, schickte sie der Stiefvater zurück. Wie mein Vater kannte sie also dieses Gefühl, hin- und hergeschubst zu werden und nirgendwo erwünscht zu sein. Als sie Anfang der dreißiger Jahre zum Hasen nach Waltenhofen kam – einem Gasthof mit Landwirtschaft, den es nach wie vor gibt – fand sie die Stelle „recht schön, wenn nur der Jais nicht wäre“. Ich erinnere mich genau an diese Worte. Doch bald funkte es zwischen den beiden, sie wurden ein Paar und heirateten 1932.
Im selben Jahr wurde mein Vater vom Knecht zum festangestellten Arbeiter. Mein Onkel Hans arbeitete im Elektroschmelzwerk in Kempten und vermittelte auch meinem Vater eine Stelle in der Fabrik. So konnten sich meine Eltern eine Wohnung suchen. Mein Vater verdiente sehr wenig, aber die Miete war günstig und sie kamen zurecht. Was muss es für meine Eltern bedeutet haben, nicht mehr Knecht und nicht mehr Magd zu sein, eine eigene Wohnung zu haben und Herr im Haus zu sein. Es vergingen noch Jahre bis zum Krieg, und das Leben war auskömmlich…